BGH-Urteil als Paradigmenwechsel bei Verwertung verpfändeter Patente, Unternehmensanteile, Marken
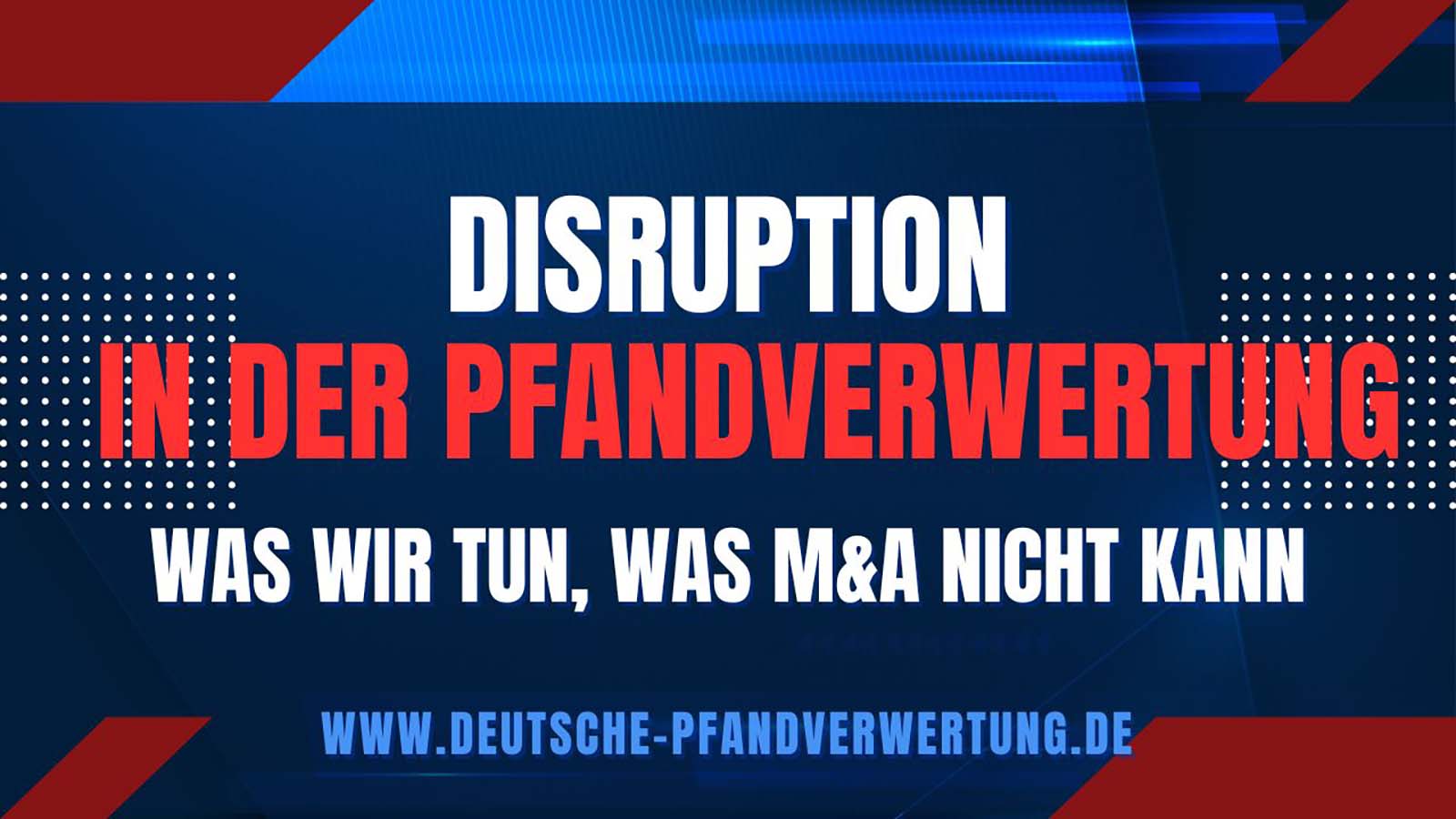
Mit Urteil vom 27. Oktober 2022 (Az. IX ZR 145/21) hat der Bundesgerichtshof einen echten Paradigmenwechsel eingeleitet: Das Verwertungsrecht nach Eintritt des Sicherungsfalls liegt bei verpfändeten Rechten – insbesondere bei Unternehmensanteilen, Markenrechten, Patenten und Lizenzen – jetzt eindeutig ausschließlich beim Pfandnehmer (Sicherungsgläubiger). Der Insolvenzverwalter kann sich für diese Rechte nicht mehr auf § 166 InsO stützen; eine analoge Anwendung lehnt der BGH ausdrücklich ab. Damit ist klargestellt: Die Entscheidung über das\“Ob\“und\“Wie\“der Verwertung dieser Rechte trifft der Pfandgläubiger – nicht der Verwalter.
Versuche, diese Rechtslageüber sogenannte Nutzungs- und Verwertungsvereinbarungen zu umgehen, laufen in der Tendenz auf eine Normumkehr hinaus und bergen das Risiko einer unzulässigen Rechtsumgehung zulasten der Pfandgläubiger und der Gläubigergesamtheit. Parallel dazu zeigt sich: Pfandgläubiger sind zunehmendsensibilisiert und bestehen verstärkt auf ihrem gesetzlichen Recht, verpfändete Rechte selbst verwerten zu lassen – und zwar nach dem rechtskonformen Weg der öffentlichen Versteigerung gemäß § 1235 BGB als gesetzlichem Regelfall der Pfandverwertung.
Pfandverwertung nach dem BGH-Urteil: Wer verwertet – und auf welcher Rechtsgrundlage?
Die Entscheidung des IX. Zivilsenats stellt zunächst klar, was der Gesetzeswortlaut bereits erkennen lässt:
• Das Verwertungsrecht des Insolvenzverwalters nach § 166 InsO umfasst
– bewegliche Sachen im Besitz des Verwalters sowie
– zur Sicherheit abgetretene Forderungen.
• Sonstige Rechte – etwa verpfändete Marken, Patente, Lizenzen oder Gesellschaftsanteile – fallen nicht darunter; eine analoge Erweiterung lehnt der BGH ausdrücklich ab.
Eine planwidrige Regelungslücke sieht der BGH nicht. Die Konsequenz ist weitreichend: Wo verpfändete Rechte betroffen sind, verbleibt das Verwertungsrecht eindeutig beim Sicherungsgläubiger.
Genau hier liegt der Paradigmenwechsel: Dieüber Jahre geübte Praxis, dass Insolvenzverwalter\“aus einer Hand\“auch verpfändete Rechte verwerten, lässt sich nach dieser Entscheidung nicht mehr auf § 166 InsO stützen. Pfandgläubiger können sich – und tun dies zunehmend – auf ihre eigene, vom BGH bestätigte Verwertungsbefugnis berufen.
Nutzungs- und Verwertungsvereinbarungen: Normumkehr und Rechtsumgehungsrisiko
Als Reaktion auf das Urteil ist in der Praxis ein anderer Trend zu beobachten: Insolvenzverwalter versuchen, die fehlende gesetzliche Verwertungsbefugnis bei verpfändeten Rechten über vertragliche Konstruktionen zu kompensieren. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Nutzungs- und Verwertungsvereinbarungen, in denen Pfandgläubiger dem Verwalter die Verwertung verpfändeter Rechte formell\“überlassen\“.
Problematisch ist daran insbesondere:
• Normumkehr: Die gesetzliche Grundentscheidung, dass der Pfandgläubiger\“Herr des Pfandrechts\“bleibt und der Verwalter bei sonstigen Rechten keine eigene Verwertungsbefugnis hat, wird faktisch umgedreht.
• Drucksituation: Pfandgläubiger befinden sich im Insolvenzumfeld häufig in einer strukturell schwächeren Position und geraten faktisch unter Druck, solchen Vereinbarungen zuzustimmen.
• Rechtsumgehung: Wird die vertragliche Konstruktion ersichtlich nur gewählt, um die klare Wertung des § 166 InsO und die BGH-Rechtsprechung zu neutralisieren, steht der Vorwurf einer unzulässigen Rechtsumgehung zulasten der Pfandgläubiger und der Gläubigergesamtheit im Raum.
Die wachsende Sensibilisierung führt dazu, dass Pfandgläubiger diese Modelle zunehmend kritisch prüfen – und den gesetzlichen Normalfall wieder ins Zentrum rücken: die eigene Verwertung nach der Pfandverwertungsordnung, nicht die delegierte Verwertung durch den Verwalter.
Haftungsrisiken für Insolvenzverwalter – und Durchgriff auf den Pfandgläubiger
Mit dem BGH-Urteil verschiebt sich nicht nur die Zuständigkeitsordnung, sondern auch das Haftungsrisiko.
Für den Insolvenzverwalter gilt:
• Nimmt er gleichwohl Einfluss auf die Verwertung verpfändeter Rechte, für die ihm kein eigenes gesetzliches Verwertungsrecht zusteht, bewegt er sich in einem haftungsträchtigen Bereich.
• Kommt es infolge einer freihändigen Verwertung zu einer Unterdeckung oder ersichtlich unterwertigen Veräußerung, drohen Haftungsansprüche nach § 60 InsO sowie deliktische Ansprüche (etwa wegen Pflichtverletzung gegenüber der Gläubigergesamtheit).
Wenig beachtet wird zudem der mögliche Durchgriff auf den Pfandgläubiger selbst, wenn dieser einer freihändigen Verwertung zustimmt und damit an der Umgehung der gesetzlichen Verwertungsordnung mitwirkt:
• Stimmt der Pfandnehmer einer Konstruktion zu, in der\“seine\“Rechte unter Wert in einer freihändigen Gesamttransaktion aufgehen, kann er sich gegenüber anderen Gläubigern dem Vorwurf aussetzen, an einer Pflichtverletzung oder sittenwidrigen Schädigung mitgewirkt zu haben.
• In der Folge kommen Schadensersatzansprüche gegen den Pfandgläubiger in Betracht, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine eigenständige, rechtskonforme Verwertung – insbesondere durch öffentliche Versteigerung – einen höheren Erlös für die Masse und damit für die Gläubiger ermöglicht hätte.
Damit wird deutlich: Wer das BGH-Urteil ignoriert und dennoch an freihändigen Verwertungslösungen mitwirkt, setzt sich nicht nur rechtspolitischer Kritik, sondern ganz konkret persönlichen Haftungsrisiken aus.
Öffentliche Versteigerung gemäß § 1235 BGB: Rechtskonformer Regelfall statt Nischenlösung
Dieöffentliche Versteigerung nach § 1235 BGB ist der vom Gesetz vorgesehene Normalfall der Pfandverwertung. Gerade im Lichte des BGH-Urteils bietet sie eine rechtskonforme und haftungsarme Struktur für die Verwertung verpfändeter Rechte:
• Rechtskonformität: Es bedarf keiner Analogie und keiner Erweiterung von Verwalterbefugnissen – das Verfahren bewegt sich vollständig im Rahmen der Pfandverwertungsordnung.
• Marktöffnung: Versteigerungen ermöglichen es, alle interessierten Bieter – etwa Wettbewerber, Finanzinvestoren oder strategische Partner – in einen Bietwettbewerb einzubeziehen.
• Dokumentierte Wertfeststellung: Der Zuschlag dokumentiert den im offenen Markt erzielten Preis; Gebote, Ablauf und Zuschlag sind nachvollziehbar und beweisbar.
• Finalität: Der Zuschlag ist als rechtsbegründender, hoheitsähnlich geprägter Akt der abschließende Punkt der Verwertung und eröffnet keine Nachverhandlung (Rückverhandlung).
Wichtig für die Gläubigerperspektive: Der aus der Versteigerung erzielte Erlös dient zunächst der Befriedigung des Pfandgläubigers. Ein darüber hinausgehender Überschuss bei einer Verwertung nach § 1235 BGB durch den Pfandgläubiger steht der Insolvenzmasse – und damit der Gläubigergesamtheit – zu, zu der unter anderem auch Finanzämter und Sozialversicherungsträger gehören. Die rechtskonforme Einzelverwertung schützt somit nicht nur die Sicherungsrechte des Pfandgläubigers, sondern wirkt auch im Interesse der übrigen Gläubiger und der öffentlichen Hand.
Ökonomische Perspektive: Brutto ist nicht gleich Netto bei Distressed M&A
Hinzu kommt ein Aspekt, der in der Debatte häufig unterschätzt wird: Die freihändige Verwertung über einen vom Insolvenzverwalter eingeschalteten M&A-Berater ist sehr teuer.
• Typische Distressed-M&A-Mandate verursachen Beraterhonorare im sechs- bis siebenstelligen Bereich.
• Diese Kosten werden nicht\“vom Himmel bezahlt\“, sondern gehen direkt vom Verwertungserlös ab.
Damit gilt in der Praxis: Brutto ist nicht gleich Netto bei M&A. Ein nominell hoher Kaufpreis sagt wenigüber den tatsächlich zur Verteilung verfügbaren Betrag aus, wenn erhebliche Intermediärskosten zuvor abgezogen werden.
Für den Pfandgläubiger hat das gleich mehrere Folgen:
• Sein Pfandobjekt finanziert über die Transaktion nicht nur die Masse, sondern zuerst die M&A-Struktur – die Eigentumsrechte und die wirtschaftliche Existenzbasis des Pfandnehmers werden dadurch real geschmälert.
• Je höher die Honorare und Transaktionskosten, desto größer die Lücke zwischen theoretischem Transaktionswert und tatsächlich ankommendem Erlös.
Scheinargumente\“Arbeitsplatzerhalt\“und\“Standortsicherung\“
Zur Rechtfertigung komplexer, teurer Distressed-M&A-Verfahren werden häufig moralische Argumente ins Feld geführt: Arbeitsplatzerhalt, Standortsicherung, Zukunftssicherung der Region. Diese Narrative mögen politisch attraktiv sein, sie sind jedoch rechtlich nicht tragendes Kriterium der Pfandverwertung.
• Weder § 1235 BGB noch § 1245 BGB stellen den behaupteten Arbeitsplatzerhalt zum Maßstab der Verwertungsentscheidung.
• Maßgeblich ist die rechtskonforme, ordnungsgemäße und wirtschaftlich sinnvolle Verwertung im Interesse der Gläubiger – nicht die Erzählung eines vermeintlich\“höheren moralischen Zwecks\“.
Tatsächlich zeigt die Praxis – und dies wird durch Studien, unter anderem von Beratungshäusern wie McKinsey, immer wieder bestätigt -, dass ein erheblicher Teil der Distressed-M&A-Verfahren wirtschaftlich scheitert:
• Transaktionen kommen nicht zum Closing,
• Finanzierungsvorbehalte greifen,
• oder das übernommene Unternehmen kann langfristig nicht stabilisiert werden.
Vor diesem Hintergrund entlarvt sich das moralische Argument als das, was es rechtlich ist: ein Scheinargument, das im Insolvenz- und Pfandrecht keine normative Verankerung hat. Es kann weder die Missachtung klarer Verwertungsregeln noch die faktische Entwertung von Pfandrechten rechtfertigen.
Einzelverwertung statt wirtschaftlicher Enteignung des Pfandgläubigers
Besonders deutlich wird die Problematik bei verpfändeten IP-Rechten und Lizenzen:
• Im Rahmen eines freihändigen Asset Deals gehen Patente, Markenrechte und Lizenzen häufig in einem Gesamtpaket auf den Erwerber über.
• Die spezifische Wertschöpfungskraft des einzelnen Rechts wird in der Preisallokation verwässert; es bleibt unklar, welcher Teil des Kaufpreises auf das konkret belastete Recht entfällt.
Für den Pfandgläubiger bedeutet dies faktisch:
• Sein Pfandobjekt\“geht mit\“- ohne eigenständige Preisbildung und ohne klar abgrenzbaren Erlös.
• De facto wird der Pfandgläubiger wirtschaftlich enteignet, wenn\“sein\“Recht nur als Teil eines Gesamtdealsübertragen wird und sein Sicherungsrecht damit im Paketpreis untergeht.
Dieöffentliche Versteigerung bietet demgegenüber den Weg der Einzelverwertung:
• Das Pfandobjekt (Patent, Marke, Lizenz, Anteil) wird isoliert oder in klar abgegrenzten Losen angeboten.
• Es kommt zu einem eigenständigen Bietwettbewerb genau um dieses Recht.
• Der Zuschlag dokumentiert den konkreten Marktpreis des Pfandgegenstands.
Davon profitiert nicht nur der Pfandgläubiger, der die Substanz seines Sicherungsrechts realisiert, sondern – über den Überschuss – auch die Masse und damit die Gläubigergesamtheit.
Unternehmensanteile, IP-Rechte und Lizenzen: Rechte mit hohem Streitpotenzial
Verpfändete Gesellschaftsanteile, Patente, Markenrechte und Lizenzen sind in Krisen- und Insolvenzsituationen häufig die werthaltigsten Vermögenswerte. Gerade hier war die Versuchung groß, im Wege einer analogen Anwendung des § 166 InsO eine zentrale Verwertung\“aus einer Hand\“durch den Insolvenzverwalter zu etablieren.
Der BGH hat diesem Ansatz eine klare Absage erteilt. Die Rechtsfolgen sind deutlich:
• Keine Verwertungsbefugnis des Insolvenzverwalters bei diesen Rechten auf Grundlage von § 166 InsO,
• Stärkung des Pfandgläubigers, der allein über die Verwertung entscheidet,
• erhöhte Anfechtungs- und Haftungsrisiken, wenn dennoch versucht wird, die Rechte faktisch über den Verwalter zu verwerten – insbesondere auf Basis von Nutzungs- und Verwertungsvereinbarungen, die die gesetzliche Wertung konterkarieren,
• und die reale Gefahr, dass der Pfandgläubiger ökonomisch benachteiligt wird, wenn\“sein\“Recht nur als Teil eines Gesamtdeals veräußert wird.
Die logische Konsequenz aus Sicht sensibilisierter Pfandgläubiger ist die konsequente Nutzung der öffentlichen Versteigerung als Instrument, das rechtliche Klarheit, dokumentierte Wertfeststellung, höhere Netto-Erlöse und eine faire Verteilung zugunsten der gesamten Gläubigerschaft miteinander verbindet.
Governance und Haftung: Warum die Wahl des Verwertungswegs zum Signal wird
Insolvenz- und Distressed-Situationen werden heute nicht nurökonomisch, sondern auch governance-getriebenbewertet. Organe, Banken, Sicherungsnehmer und Insolvenzverwalter müssen ihre Entscheidungen zunehmend gegenüber Aufsichtsbehörden, Gerichten, Gläubigerversammlungen und im Rahmen eigener Haftungsrisiken rechtfertigen.
Vor diesem Hintergrund wird die Wahl des Verwertungswegs zum klaren Signal:
• Entscheidet sich der Pfandgläubiger für die öffentliche Versteigerung, kann er sich auf das gesetzliche Leitbild der Pfandverwertung, die dokumentierte Marktöffnung, die isolierte Wertfeststellung des Pfandobjekts und die hoheitsähnlich geprägte Finalität des Zuschlags berufen.
• Setzt er hingegen auf freihändige Verwertungskonstruktionen, die den Insolvenzverwalter trotz BGH-Rechtsprechung wieder in die Verwertung verpfändeter Rechte hineinziehen – etwa über Nutzungs- und Verwertungsvereinbarungen -, steht er erklärungsbedürftig da und läuft Gefahr, sich dem Vorwurf einer Normumkehr, einer Rechtsumgehung, einer wirtschaftlichen Enteignung des eigenen Sicherungsrechts und einer Benachteiligung derübrigen Gläubiger auszusetzen.
Fazit zum Paradigmenwechsel
In der Summe führt das BGH-Urteil daher zu einem Paradigmenwechsel: weg von der faktischen Verwertungshoheit des Insolvenzverwalters bei verpfändeten Rechten, hin zur Ausübung des Verwertungsrechts durch den Pfandgläubiger – ausschließlich über die öffentliche Versteigerung nach § 1235 BGB.
Zum YouTube-Video>hier klicken.
Categories: Allgemein
No Responses Yet
You must be logged in to post a comment.